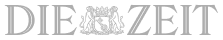-
24/7 können Sie uns schreiben Fall schildern
-
Ihr kostenloses Erstgespräch 08031 / 7968029
-
Sie brauchen sofort Hilfe? Termin eintragen

Gesellschafterbürgschaft
Eine Gesellschafterbürgschaft kommt vor allem bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) zum tragen. Allerdings unterschätzen Bürgen regelmäßig die Gefahren, die in Verbindung mit einer solchen, speziellen Bürgschaft stehen. Ein Risiko besteht darin, dass der Bürge noch Jahre nach Erfüllung bestehender Kreditforderungen in Anspruch genommen werden kann, sollte die GmbH in die Insolvenz gehen.
Inhalte des Artikels
Das Wichtigste im Überblick
- Bei einer Gesellschafterbürgschaft bürgt ein Gesellschafter für sein eigenes Unternehmen, meistens eine GmbH.
- Die Gesellschafterbürgschaft ist für den Bürgen mit einem höheren Risiko verbunden, da er bei Insolvenz der GmbH oder einer anderen Kapitalgesellschaft in großem Umfang in Anspruch genommen werden kann.
- Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine abgegebene Gesellschafterbürgschaft im Nachhinein anzufechten, insbesondere bei einer geplanten Inanspruchnahme.
Seit Jahren berät und begleitet CDR Legal Mandanten im Bankrecht, Erbrecht, Kapitalmarktrecht und Insolvenzrecht. Die Kanzlei bietet, Erbrechtsfälle ausgenommen, eine kostenlose Ersteinschätzung und vertritt Sie gerne darüber hinaus, wenn in Ihrem Fall gute Erfolgschancen bestehen.
Kostenlose
Ersteinschätzungen
Mandanten
Insgesamt
Ø-Bewertung aus
388 Rezensionen
Anvertraute
Streitwerte
Kostenlose
Ersteinschätzung
Deckungszusage
Rechtsschutz
Anspruch durchsetzen
bzw. abwehren
CDR Legal bietet korrekte, günstige und zielführende Rechtsdienstleistungen. Im Gegensatz zu vielen anderen Kanzleien übernehmen wir nur Fälle mit echten Erfolgschancen und stellen Ihnen nichts Unerwartetes in Rechnung. Sie werden stets informiert, behalten die Kostenkontrolle und profitieren von unserer langjährigen Erfahrung in unseren Spezialgebieten. Weiterlesen
Worum handelt es sich bei der Gesellschafterbürgschaft?
Bei Kapitalgesellschaften haftet normalerweise das Unternehmen als juristische Person für Verbindlichkeiten, beispielsweise für einen aufgenommenen Kredit. Die persönliche Haftung der Gesellschafter hingegen ist normalerweise ausgeschlossen bzw. begrenzt, insbesondere bei einer GmbH.
Da sich Banken häufig nicht alleine auf die Bonität des Unternehmens verlassen möchten, wird oftmals eine sogenannte Gesellschafterbürgschaft gefordert. Gesellschafterbürgschaften sind Bürgschaftsverpflichtungen, die ein Gesellschafter für sein Unternehmen eingeht. Die Bürgschaftsverpflichtung resultiert aus der Hauptschuld, die zum Beispiel eine GmbH gegenüber der Bank in Form eines aufgenommenen Kredites hat.
Grundsätzlich sind Gesellschafterbürgschaften streng akzessorisch. Das bedeutet, dass die Existenz der jeweiligen Bürgschaft mitsamt der Ansprüche, die der Gläubiger hat, vom Bestehen einer Hauptforderung abhängig sind. Wird die Hauptschuld nach Übernahme der Bürgschaft erweitert, gilt diese Vereinbarung nur zwischen Schuldner und Gläubiger, wirkt sich jedoch nicht auf abgegebene Gesellschafterbürgschaften aus.
Die Bürgschaft eines Gesellschafters ist sehr weitreichend. Sie beinhaltet zum Beispiel, dass der Gesellschafter selbst dann bei Insolvenz des Unternehmens noch in Anspruch genommen werden kann, wenn die eingegangene Verpflichtungen Jahre in der Vergangenheit liegen. Zudem haftet der Gesellschafter unter anderem mit seinem Privatvermögen.
Rechtliche Grundlagen für die Gesellschafterbürgschaft
Es gibt einige rechtlichen Grundlagen für eine Bürgschaft, die Gesellschafter für ihre Gesellschaft übernehmen. Dabei geht es insbesondere um Fragen der Haftung und die Risiken, die der Bürge mit der Übernahme der Bürgschaften eingeführt. Eine erste Verpflichtung des Bürgen ergibt sich aus Paragraph 765 Abs. 1 BGB.
Demnach ist der Bürge als Gesellschafter dazu verpflichtet, für Verbindlichkeiten der GmbH gegenüber den entsprechenden Gläubigern einzustehen. Die Bürgschaft muss nur dann nach § 766 S. 1 BGB die Schriftform haben, falls es sich beim Bürgen nicht um einen Kaufmann und bei der Bürgschaft aus seiner Sicht nicht um ein Handelsgeschäft handelt. Ansonsten kann die Bürgschaft formfrei vereinbart werden.
Wie funktioniert die Gesellschafterbürgschaft - ein Praxisbeispiel
Die Funktionsweise einer Gesellschafterbürgschaft lässt sich gut an einem Praxisbeispiel verdeutlichen. Dazu nehmen wir an, dass die Scholz & Meyer GmbH bei der Hausbank ein Darlehen aufnehmen möchte. Das existierende Geschäftsvermögen der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist aus Sicht des Kreditgebers allerdings nicht als Sicherheit ausreichend.
Der Gesellschafter lässt sich jedoch mit seinem Privatvermögen nicht heranziehen, da die Haftung bei einer GmbH auf das Geschäftsvermögen beschränkt ist. Deshalb fordert das Kreditinstitut vom Gesellschafter eine Gesellschafterbürgschaft. Daraufhin wird eine Bürgschaftsvereinbarung getroffen, die einen Vertrag zwischen dem Gesellschafter und der kreditgebenden Bank darstellt.
Das Unternehmen selbst, also die GmbH, ist hingegen nicht an dieser Vereinbarung beteiligt. Wichtig zu beachten ist, dass der Bürgschaftsvertrag mindestens folgende Elemente beinhalten muss:
- Identität des Schuldners, des Gläubigers sowie des Bürgen
- Aufführen der abzusichernden Forderung (im Beispielfall Darlehen der Bank)
- Verpflichtung des Bürgen, dass dieser die offenen Forderungen der Bank begleicht, sollte die GmbH zahlungsunfähig werden.
Zwar ist der Bürgschaftsvertrag zwar auch formfrei rechtens, wenn es sich beim Bürgen um einen Kaufmann und gleichzeitig bei der Bürgschaft um ein Handelsgeschäft handelt. Dennoch wird aus Beweisgründen nahezu immer ein schriftlicher Bürgschaftsvertrag abgeschlossen.
Auftragsverhältnis als Basis zwischen Bürgen und Gesellschaft
Ein Aspekt ist im Zusammenhang mit der Gesellschafterbürgschaft noch von Bedeutung, nämlich dass ein Auftragsverhältnis zwischen dem Bürgen und dem Unternehmen, für welches er bürgt, besteht. Dieses Auftragsverhältnis gründet sich dadurch, dass die Gesellschaft ihren Gesellschafter quasi beauftragt, dass dieser gegenüber dem Unternehmen eine Bürgschaft übernimmt. Sollte der Gesellschafter tatsächlich in Anspruch genommen werden, hat er gegenüber seiner Gesellschaft das Recht auf Aufwandsersatz und die Erstattung der von ihm geleisteten Zahlungen.
Nichtigkeit der Gesellschafterbürgschaft
Mitunter kann eine Bürgschaftserklärung zur Gesellschafterbürgschaft im Nachhinein nichtig werden, wenn beispielsweise eine Sittenwidrigkeit nach Paragraph 138 BGB vorliegt. Ein Grund kann in einer wesentlichen, finanziellen Überforderung des Bürgen besteht. Auf die mögliche Sittenwidrigkeit einer Gesellschafterbürgschaft gehen wir in einem anderen Beitrag noch sehr ausführlich ein.
Wann wird der Bürge aus der Gesellschafterbürgschaft in Anspruch genommen?
Natürlich hofft der Gesellschafter als Bürge, dass seine GmbH stets liquide ist und keine Zahlungsunfähigkeit eintritt. Dennoch passiert es in der Praxis nicht selten, dass der Bürge tatsächlich in Anspruch genommen wird. Die Inanspruchnahme des Gesellschafters als Bürge kommt vor allem bei einer Insolvenz der GmbH infrage.
In diesem Fall haftet der Gesellschafter praktisch doppelt, nämlich zum einen mit seiner Gesellschaftereinlage in der GmbH, die zum Begleichen offener Forderungen der Gläubiger genutzt werden muss. Zum anderen haftet er im Rahmen der eingegangenen Bürgschaftsverpflichtung auch mit seinem Privatvermögen.
Allerdings ist es nicht selten der Fall, dass Schulden, die durch eine Gesellschafterbürgschaft abgesichert sind, gemäß Paragraph 39 Insolvenzordnung nachrangig sind. Auf dieser Grundlage ergeben sich im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des Bürgen die folgenden Fakten:
- Keine steuerliche Verwertung einer unmittelbaren Zahlung durch Gesellschafter an den entsprechenden Gläubiger
- Gesellschafter muss nicht selten zweifach zahlen, nämlich einmal mit seiner Gesellschaftereinlage und zum anderen als Bürge
- Die GmbH-Mindesteinlage ist steuerlich verwertbar und wird deshalb vorgezogen
- Bürgen sollten bei drohender Insolvenz ihrer Gesellschaft prüfen, ob ihre Geschäftseinlage zur Tilgung der Schulden genutzt werden kann, für die sie sich verbürgt haben. Dies basiert auf Paragraphen 39 Abs. 1 Nr. 5 Insolvenzordnung
Innenverhältnis: Rechtslage zwischen mehreren Gesellschaftern
In der Regel gibt es bei einer GmbH oder anderen Kapitalgesellschaften nicht nur einen, sondern mehrere Gesellschafter. Dann stellt sich durchaus auch im Zusammenhang mit der Gesellschafterbürgschaft die Frage, wie sich die Verhältnisse im Innenbereich darstellen.
Nehmen wir an, es gibt bei einer GmbH zwei Gesellschafter und diese haben gegenüber der Bank jeweils eine Gesellschafterbürgschaft abgegeben. In diesem Fall haften die jeweiligen Mitbürgen einander auf Grundlage des Paragraphen 426 BGB. Gibt es keine anders lautende Vereinbarung, sind die Gesamtschuldner im Innenverhältnis zu gleichen Teilen zueinander verpflichtet.
Sollte ein Gläubiger von einem der zwei Bürgen befriedigt worden sein, greift das sogenannte Ausgleichsverhältnis zwischen den Mitbürgen. Dieses beinhaltet, dass die erbrachte Leistung auf Basis der Paragraphen 774 Abs. 2 und 4426 BGB auf alle Mitbürgen zu gleichen Anteilen zu verteilen ist.
Bürge wird in Anspruch genommen: Welche Rechte hat der Gesellschafter?
Sollte der Gesellschafter aus einer Gesellschafterbürgschaft in Anspruch genommen werden und die Hauptforderung des Gläubigers begleichen, gehen sämtliche Neben- und Sicherungsrechte sowie selbstverständlich ebenso die Hauptforderung, für die er sich verbürgt hat, auf ihn über. Das bedeutet, dass der Gesellschafter gegenüber seiner eigenen Gesellschaft finanzielle Ansprüche hat.
Normalerweise ist im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen seitens Banken allerdings festgelegt, dass dieser Übergang der Forderungen erst dann stattfindet, nachdem alle offenen Forderungen des Kreditinstitutes beglichen worden sind. Immerhin hat der Bürge das Recht, andere Sicherungsgeber anteilig bezüglich des Ersatzes geleisteter Zahlungen zu beanspruchen.
So kann CDR Legal Ihnen helfen
Für in Anspruch genommene Bürgen ist es wichtig, zunächst zu prüfen, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, die Forderungen des Gläubigers zu begleichen. Im ersten Schritt sollte der Bürge, der gleichzeitig Gesellschafter des Unternehmens ist, überprüfen, ob das Vermögen der Gesellschaft mitsamt der Gesellschaftereinlagen bereits ausreicht, um die Schulden zu begleichen.
Im zweiten Schritt sollte der Bürge ebenfalls prüfen, ob es noch andere Sicherungsgeber gibt, fernab sonstiger Gesellschafter. Darüber hinaus ist es sinnvoll, möglichst schnell offene Forderungen seitens der Gesellschaft einzutreiben, damit dieser Kapitalzufluss genutzt werden kann, um zumindest einen Teil der gegen das Unternehmen gerichteten Forderungen zu begleichen.
In einem weiteren Schritt kann es manchmal sinnvoll sein, dass der Bürge eine mögliche Sittenwidrigkeit der eingegangenen Bürgschaftserklärung überprüfen lässt. Dazu wiederum ist sinnvoll, sich an einen erfahrenen Rechtsanwalt zu wenden. Dieser sollte im besten Fall auf Bank- und Kapitalmarktrecht spezialisiert sein, wie es bei der Kanzlei CDR-Legal der Fall ist.
Im Überblick ist es empfehlenswert, dass Sie als Gesellschafter und Bürge zunächst folgende Fakten überprüfen, bevor Sie eine Zahlung vornehmen:
- Kann die Gesellschaftereinlage zum Begleichen der Forderungen genutzt werden?
- Bestehen seitens der Gesellschaft offene Forderungen, die möglichst schnell eingetrieben werden können?
- Gibt es noch andere Sicherungsgeber, die für die Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft einstellen müssen?
- Liegt bei der Bürgschaftserklärung Sittenwidrigkeit vor oder ist diese Bürgschaft anderweitig anfechtbar?
- Falls Letzteres in Erwägung gezogen wird: Durch einen erfahrenen Rechtsanwalt beraten lassen
RA Corinna D. Ruppel (LL.M.) berät und begleitet Sie im Bankrecht, im Erbrecht, im Kapitalmarktrecht und im Insolvenzrecht. Rechtsanwältin Ruppel ist Spezialistin im Prüfen, Durchsetzen und Abwehren von Forderungen. Seit 2013 ist Frau Ruppel Inhaberin der Kanzlei CDR Legal und hat bereits über 9.000 Erstberatungen erteilt und mehr als 2.000 Mandanten vertreten.