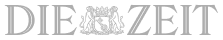-
24/7 können Sie uns schreiben Fall schildern
-
Ihr kostenloses Erstgespräch 08031 / 7968029
-
Sie brauchen sofort Hilfe? Termin eintragen
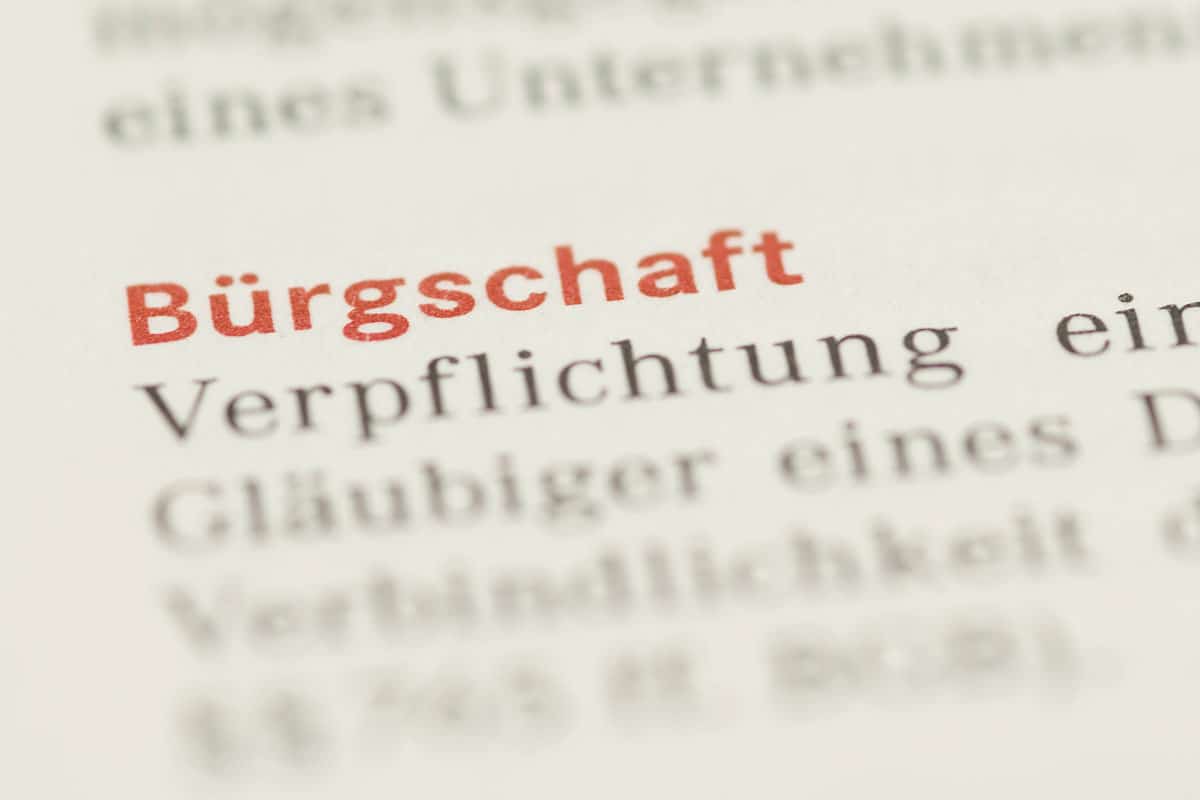
Sittenwidrigkeit bei Gesellschafterbürgschaften
Insbesondere in Krisenzeiten drohen zahlreiche Gesellschaften in eine Schieflage zu geraten. Vor diesem Hintergrund lassen sich GmbH Gesellschafter häufiger auf eine Gesellschafterbürgschaft ein. Dieser Schritt sollte jedoch gut überlegt werden. Es gibt nur wenige Ausnahmefälle, in denen der Bürge unbeschadet aus der Bürgschaft herauskommt, sollte er nicht zuvor schon in Anspruch genommen worden sein.
Inhalte des Artikels
Das Wichtigste im Überblick
- Ist der Gesellschafter einer GmbH Bürge, dann gibt es nur in wenigen Ausnahmefällen die Möglichkeit, eine sittenwidrige Bürgschaft darzulegen.
- Eine krasse finanzielle Überforderung lassen die Gerichte in der Regel bei einem GmbH Gesellschafter als Bürge nicht gelten.
- Sollte der GmbH Gesellschafter auf Sittenwidrigkeit klagen, muss er den entsprechenden Beweis führen. Das ist in der Praxis äußerst schwer.
Seit Jahren berät und begleitet CDR Legal Mandanten im Bankrecht, Erbrecht, Kapitalmarktrecht und Insolvenzrecht. Die Kanzlei bietet, Erbrechtsfälle ausgenommen, eine kostenlose Ersteinschätzung und vertritt Sie gerne darüber hinaus, wenn in Ihrem Fall gute Erfolgschancen bestehen.
Kostenlose
Ersteinschätzungen
Mandanten
Insgesamt
Ø-Bewertung aus
388 Rezensionen
Anvertraute
Streitwerte
Kostenlose
Ersteinschätzung
Deckungszusage
Rechtsschutz
Anspruch durchsetzen
bzw. abwehren
CDR Legal bietet korrekte, günstige und zielführende Rechtsdienstleistungen. Im Gegensatz zu vielen anderen Kanzleien übernehmen wir nur Fälle mit echten Erfolgschancen und stellen Ihnen nichts Unerwartetes in Rechnung. Sie werden stets informiert, behalten die Kostenkontrolle und profitieren von unserer langjährigen Erfahrung in unseren Spezialgebieten. Weiterlesen
Grundlage für die Verpflichtung eines Gesellschafters zur Bürgschaft
Es gibt im Wesentlichen zwei Wege, wie Gesellschafter dazu verpflichtet werden können, Bürgschaften für ihr Unternehmen zu übernehmen. Eine Möglichkeit besteht darin, diese sogenannte Leistungspflicht innerhalb des Gesellschaftsvertrages zu regeln. Diese Variante basiert auf Paragraph 3 Abs. 2 GmbHG.
Wirksam ist eine derartige Bestimmung in der Satzung allerdings nur unter der Voraussetzung, dass im Detail festgelegt ist, worin der Leistungsumfang des Gesellschafters besteht. Es darf demzufolge keine allgemeinen Formulierungen geben, wie zum Beispiel, dass der Gesellschafter grundsätzlich Bürgschaften für sämtliche Verbindlichkeiten der GmbH übernehmen muss.
Eine entsprechende Satzungsbestimmung hat vorrangig die folgenden Ziele:
- Höhe der Bürgschaft festlegen
- Voraussetzungen für die Übernahme der Bürgschaft darlegen
- Ende der Verpflichtung (zeitlich) definieren
Eine Alternative zur Verpflichtung seitens des Gesellschafters hinsichtlich der Übernahme von Bürgschaften ist eine außerhalb der Satzung stattfindende Regelung. Hier kommen insbesondere vertragliche Vereinbarungen zwischen dem Gesellschafter und dem Unternehmen infrage, bei denen es vorwiegend um die Einzelverpflichtung eines Gesellschafters geht.
Prinzipielle Gründe für die Sittenwidrigkeit einer Bürgschaft
Bevor wir explizit der Frage nachgehen, unter welchen Voraussetzungen die Bürgschaft eines GmbH Gesellschafters eventuell sittenwidrig sein könnte, möchten wir kurz die generellen Gründe für eine mögliche Sittenwidrigkeit von Bürgschaften nennen.
Rechtliche Grundlage für eine eventuelle Sittenwidrigkeit ist der Paragraph 138 BGB. Prinzipiell gibt es insbesondere die folgenden drei Voraussetzungen, bei deren Vorliegen davon ausgegangen werden kann, dass die Bürgschaft sittenwidrig ist:
- Starke emotionale Bindung zwischen Hauptschuldner und Bürge
- Bürge hat kein persönliches oder wirtschaftliche Interesse an der Vergabe des Kredites
- Krasse finanzielle Überforderung seitens des Bürgen durch die Bürgschaftsverpflichtung
Zu den möglichen Gründen, warum eine Bürgschaft als sittenwidrig betrachtet werden kann, gehört ebenso das Einschränken der Entscheidungsfreiheit seitens des Bürgen. Wenn es um eine eventuelle Sittenwidrigkeit der Bürgschaft eines GmbH Gesellschafters geht, dann kommen fast nur eine eventuelle finanzielle Überforderung nebst zu starker emotionaler Bindung an einen anderen Gesellschafter als mögliche Ursache für die Sittenwidrigkeit infrage.
Wann kann die Bürgschaft eines GmbH Gesellschafters sittenwidrig sein?
Im Grunde kann es bei einem Geschäftsführer bzw. Gesellschafter einer GmbH nur einen Grund geben, warum die Bürgschaft sittenwidrig sein könnte: Finanzielle Überforderung des Bürgen in erheblichem Umfang in Verbindung mit (zu) starker emotionaler Bindung. Um zu verstehen, dass diese Einwände allerdings für Gesellschafter einer GmbH nur in Ausnahmefällen zum Tragen kommen, müssen wir generell etwas mehr auf die erhebliche finanzielle Überforderung als solche eingehen.
Exkurs: Was versteht man unter erheblicher, finanzieller Überforderung eines Bürgen?
Die sogenannte „krasse“ finanzielle Überforderung seitens des Bürgen ist einer der Hauptgründe, warum eine Bürgschaft generell als sittenwidrig zu betrachten ist. Es gibt allerdings keine einheitliche Definition, ab wann von einer solchen deutlichen Überforderung zu sprechen ist.
Trotzdem wird anhand einer Reihe von Gerichtsurteilen relativ klar, was normalerweise mit einer krassen finanziellen Überforderung gemeint ist. In der Regel ist dann von einer erheblichen finanziellen Überforderung auszugehen, wenn der Bürge voraussichtlich nicht dazu in der Lage sein wird, die Zinsen aus der gegen ihn gerichteten Forderung zu zahlen, und zwar mit dem pfändbaren Teil seines Einkommens.
Anders ausgedrückt könnte man es so formulieren, dass eine erhebliche Überforderung anzunehmen ist, falls die durch den Bürgen übernommene Verpflichtung höher als dessen Leistungskraft ist. Das ist regelmäßig der Fall, wenn bereits bei Abschluss des Bürgschaftsvertrages davon ausgegangen werden muss, dass der Bürge bei späterer Inanspruchnahme ohnehin nicht in der Lage sein wird, der Forderung nachzukommen.
Handelt es sich um eine krasse finanzielle Überforderung, bedeutet dies allerdings noch nicht, dass die Bürgschaft auf Grundlage des Paragraphen 138 BGB sittenwidrig ist. Generell muss noch ein Aspekt hinzu kommen, nämlich ein sogenanntes Ungleichgewicht zwischen den zwei Vertragsparteien. Dies wiederum wird vor allem dann angenommen, wenn es eine starke emotionale Bindung zwischen dem Bürgen und dem Hauptschuldner gibt bzw. beide Parteien einen unterschiedlichen Wissensstand bezüglich der eingegangenen Verpflichtungen haben.
Krasse Überforderung bei Gesellschaftern als Bürgen meistens nicht gegeben
Was bedeutet nun die mögliche Sittenwidrigkeit einer Bürgschaft aufgrund einer krassen finanziellen Überforderung des Bürgen konkret für Gesellschafterbürgschaften? Eine Vermutung der krassen, finanziellen Überforderung kommt einerseits bei Privatpersonen in deren Funktion als Bürge häufiger zum Tragen.
Auf der anderen Seite haben bereits mehrere Gerichte klargestellt, unter anderem der BGH, dass eine derartige Vermutung nicht bei Gesellschaftern anzuwenden ist, die für ihre GmbH bürgen. Dies hat der Bundesgerichtshof insbesondere in seinem Urteil vom 15. Januar 2002 unter dem Az. XI ZR 98/01 festgestellt.
Die Begründung des Bundesgerichtshof hebt hervor, dass es normalerweise für den Gesellschafterbürgen kein unzumutbares Risiko ist, für die Schulden der eigenen Gesellschaft einzustehen. Zudem habe die kreditgebende Bank selbstverständlich ein berechtigtes Interesse daran, dass der Gesellschafter als Bürge in die persönliche Haftung eintritt, was er in seiner Funktion als Gesellschafter einer GmbH normalerweise nicht muss.
Insofern ist bei einer Gesellschafterbürgschaft seitens des Bürgen nicht von einer Sittenwidrigkeit auszugehen, da weder eine ungewöhnlich große emotionale Verbundenheit besteht noch der Bürge in aller Regel krass finanziell überfordert ist. Falls entsprechende Bürgen dennoch behaupten, dass sie ausschließlich aufgrund einer persönlichen und sehr engen Verbundenheit zu einem Dritten (anderer Gesellschafter) die Bürgschaft eingegangen sind, müssen sie dies ebenso beweisen wie die Tatsache, dass der Gläubiger dies gewusst hätte bzw. hätte wissen müssen.
Aus dem Urteil des Bundesgerichtshofes lässt sich generell ableiten, dass normalerweise bei Bürgen als Gesellschafter einer GmbH weder eine finanziell krasse Überforderung noch eine zu starke emotionale Verbundenheit angenommen werden kann. Daher greift normalerweise die Sittenwidrigkeit nach Paragraph 138 BGB nicht.
Allerdings gibt es in der Hinsicht zwei Ausnahmefälle, bei deren Vorliegen wiederum anzunehmen ist, dass die emotionale Verbundenheit des Gesellschafters wesentlich größer als die wirtschaftlichen Interessen an der Bürgschaft sind. Eine dieser Ausnahmen beinhaltet, dass der Bürge in seiner Funktion als Gesellschafter nur eine sogenannte Bagatellebeteiligung an der Gesellschaft hat.
Das wäre anzunehmen, falls dem Gesellschafter lediglich eine Beteiligung von weniger als 10 Prozent zusteht. Die zweite Ausnahme ist dann gegeben, falls die kreditgebende Bank als Gläubigerin einen der folgenden Punkte beim Gesellschafter festgestellt hat:
- Stellung des Gesellschafters ist nicht mit finanziellen Interessen oder einer Beteiligung bezüglich der Gesellschaft verbunden
- Bürgschaft des Gesellschafters ohne wirtschaftliche Interessen
- Keine finanzielle Beteiligung an der Gesellschaft
- Bürgschaft wird ausschließlich aufgrund starker persönlicher Verbundenheit mit einer anderen Person eingegangen, die an der GmbH beteiligt ist
Das Problem an diesen Ausnahmefällen ist allerdings, dass diese nur sehr schwer nachweisbar sind, sodass sie in der allgemeinen Rechtsauffassung und in der Praxis eher zu vernachlässigen sind.
Rechtsgrundlage / Urteil des BGH zur Sittenwidrigkeit der Gesellschafterbürgschaft
Dass bis heute nur in ganz wenigen Fällen die Sittenwidrigkeit einer Gesellschafterbürgschaft nachzuweisen ist, ist vor allem auf das bereits angesprochene Urteil des Bundesgerichtshofes zurückzuführen. Daher macht es Sinn, sich etwas näher mit dem damaligen Sachverhalt und den Entscheidungsgründen des BGH zu beschäftigen.
Im verhandelten Fall beschäftigt sich der Bundesgerichtshof damit, ob die Bürgschaft einer GmbH-Gesellschafterin als sittenwidrig anzusehen ist, da die Gesellschafterin lediglich ein „Strohmann“ war, eine finanzielle Überforderung bestand und die Verpflichtung angeblich ausschließlich aufgrund einer starken, emotionalen Verbundenheit eingegangen ist. Im verhandelten Fall klagte eine Sparkasse als Gläubigerin.
Die Sparkasse hatte einer GmbH Darlehen über insgesamt zwei Millionen D-Mark zwischen November 1993 und April 1994 gewährt. Bei der Beklagten handelt es sich um eine Gesellschafterin als Bürgin, die einen Anteil von 25 Prozent an der GmbH innehatte. Es gab noch drei weitere Gesellschafter mit gleichen Anteilen.
Die Beklagte hatte 1993 eine Höchstbetragsbürgschaft über 500.000 D-Mark für die GmbH übernommen, die sich auf sämtliche existierende und zukünftige Forderungen seitens der Sparkasse bezog. Zu diesem Zeitpunkt war die Beklagte erwerbsunfähig und arbeitete als Hausfrau. Die Einkünfte bestanden lediglich in einem „Hausgeld“, welches sie vom Ehemann in Höhe von monatlich 2.000 D-Mark erhielt. Anschließend verdiente die Beklagte nach ihrer Scheidung als Angestellte monatlich 4.000 DM brutto.
Neben der Bürgschaft erhielt die Sparkasse weitere Sicherheiten, insbesondere eine erstrangige Grundschuld über zwei Millionen D-Mark, die sich auf das Werksgrundstück der GmbH bezog. Ferner gab es eine Sicherungsübereignung des Anlage- und Umlaufvermögens sowie eine Sicherungsabtretung von Forderungen.
Zur Kreditkündigung durch die Klägerin kam es 1995, nachdem seitens der GmbH eine Gesamtvollstreckung über das Vermögen beantragt wurde. In dem Zusammenhang nahm die Sparkasse die Gesellschafterin als Bürgin in voller Höhe mit 500.000 DM in Anspruch. Dagegen wehrte sich die Beklagte jedoch, indem sie auf die Sittenwidrigkeit der Bürgschaft verwies.
Als Grund wurde insbesondere eine krasse finanzielle Überforderung angegeben. Ferner gab die Beklagte an, dass sie lediglich aus steuerlichen Gründen Gesellschafterin der GmbH gewesen sei, jedoch in keiner Weise Entscheidungen im Hinblick auf das operative oder organisatorische Geschäft getroffen hätte. Zudem habe sie keinerlei Fachkenntnisse und Erfahrungen in dem Bereich gehabt haben, in welchem die Gesellschaft tätig war.
Da die Beklagte zudem ihre Anteile an den Ehemann übertrug, gab sie darüber hinaus an, dass sie lediglich als „Strohfrau“ tätig war und die Sparkasse darüber Kenntnis gehabt habe. Darüber hinaus gab die Beklagte an, sie habe die entsprechende Bürgschaftserklärung ohne genaueres Hinsehen unterschrieben. Zudem habe der Ehemann sie insoweit getäuscht, als dass er ihr versichert hätte, dass keine finanziellen Risiken mit der Unterschrift verbunden seien.
Entscheidung des Bundesgerichtshofes gegen die Beklagte
Der BGH entschied im verhandelten Fall, dass die durch die Beklagte übernommene Bürgschaft nicht sittenwidrig wäre und demzufolge Paragraph 138 Abs. 1 BGB nicht angewendet werden könnte. Dabei führte der BGH zur Begründung insbesondere an, dass bei einer Gesellschafterin als Bürgin eine krasse finanzielle Überforderung genauso wenig wie eine zu starke emotionale Verbundenheit mit einem Hauptgesellschafter ausreichen würde, dass von einer Sittenwidrigkeit auszugehen ist.
Dabei betonte der BGH, dass dies selbst unter der Voraussetzung gelten würde, dass die Gesellschafterin lediglich ein Strohmann sei, wie die Beklagte angab. Die Sittenwidrigkeit wäre stattdessen nur unter der Voraussetzung gegeben, dass der Kreditgeber hätte erkennen müssen, dass seitens der Bürgin eine finanzielle Benachteiligung existiert und die Gesellschafterin kein wirtschaftliches Interesse gehabt hätte. Dies jedoch konnte im verhandelten Fall nicht nachgewiesen werden.
Bürgschaft eines Gesellschafters sittenwidrig: Wer ist in der Beweispflicht?
Der vorliegende Fall, bei dem der Bundesgerichtshof sich eindeutig auf die Seite der Klägerin stellte und damit urteilte, dass die Bürgschaft nicht sittenwidrig sei, zeigt eins deutlich: Die Beweispflicht einer eventuellen Sittenwidrigkeit der Gesellschafterbürgschaft liegt eindeutig beim Bürgen selbst.
Das Urteil des BGH zeigt weiterhin, dass - trotz augenscheinlich guter Gründe - die Beweise stichhaltig und nahezu wasserdicht sein müssen, damit tatsächlich die Sittenwidrigkeit der Bürgschaft dargelegt werden kann. In der Praxis zeigt sich dies als äußerst schwierig, sodass die weitaus meisten Gesellschafterbürgschaften nicht als sittenwidrig zu beweisen sind.
Sittenwidrige Gesellschafterbürgschaft: Was wäre die Konsequenz?
Sollte der Gesellschafterbürge mit seiner Einrede der Sittenwidrigkeit wider Erwarten Erfolg haben, ergeben sich daraus selbstverständlich weitere Konsequenzen. Die Hauptfolge ist, dass der Bürgschaftsvertrag unwirksam wäre. Das wiederum führt dazu, dass der Gläubiger den Bürgen nicht mehr in Anspruch nehmen kann.
Das wiederum führt dazu, dass der Gesellschafter der GmbH nicht mehr mit seinem Privatvermögen haftet, wie es in der Funktion als Bürge der Fall gewesen wäre. Stattdessen bleibt die Haftung ausschließlich auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt und der Bank geht damit im Grunde eine wichtige Sicherheit verloren. Das wiederum könnte dazu führen, dass der Kreditgeber bestehende Darlehen an die GmbH kündigt, weil ihm die effektiv noch existierenden Sicherheiten nicht mehr ausreichen.
Fazit zur Sittenwidrigkeit einer Bürgschaft durch GmbH-Gesellschafter
Abschließend lässt sich festhalten, dass die Einrede der Sittenwidrigkeit bei einer Gesellschafterbürgschaft nur selten Erfolg hat. In der überwiegenden Mehrheit aller verhandelten und vorstellbaren Fälle dürfte der Bürge keine ausreichenden Beweise haben, insbesondere dann nicht, wenn er sich auf eine krasse finanzielle Überlastung oder eine zu starke emotionale Verbundenheit an einen anderen Gesellschafter den GmbH beruft.
Lediglich in wenigen Ausnahmefällen und bei wasserdichten Beweisen urteilen die Gerichte manchmal in der Form, als dass die Gesellschafterbürgschaft tatsächlich als sittenwidrig angesehen wird. Aus dem Grund sollten sich Gesellschafter einer GmbH unbedingt des umfangreichen Risikos bewusst sein, welches sie mit einer Bürgschaftsverpflichtung gegenüber ihrer Gesellschaft eingehen.
Kostenloses Erstgespräch
Auch wenn es sicherlich sowohl geschäftlich als auch menschlich verständlich ist, dass man sich gegenüber seinem Unternehmen besonders verpflichtet fühlt. Trotzdem ist darauf hinzuweisen, dass ein GmbH-Gesellschafter nicht umsonst diese Rechtsform gewählt hat, weil eben eine Begrenzung der Haftung auf das Gesellschaftsvermögen existiert. Geht der Gesellschafter dann jedoch eine Bürgschaft ein, hebt er diesem Vorteil auf, da er als Bürge auch mitsamt seinem Privatvermögen für eventuelle Schulden der GmbH haftet.
F.A.Q.
Wer bürgt für eine GmbH?
Bei einer GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) ist die Haftung auf das Stammkapital der Gesellschaft beschränkt. Daher bürgt grundsätzlich die GmbH selbst für ihre Verbindlichkeiten. Die Gesellschafter haften nur in Höhe ihrer Stammeinlagen und nicht persönlich mit ihrem Privatvermögen. In bestimmten Fällen, wie bei einer Verletzung von Sorgfaltspflichten durch die Geschäftsführung, kann jedoch eine persönliche Haftung der Geschäftsführer eintreten.
Kann eine GmbH selbstschuldnerisch bürgen?
Ja, eine GmbH kann grundsätzlich selbstschuldnerisch bürgen. Bei einer selbstschuldnerischen Bürgschaft verpflichtet sich der Bürge, für die Schulden des Hauptschuldners einzustehen, ohne dass der Gläubiger zunächst alle rechtlichen Schritte gegen den Hauptschuldner ausgeschöpft haben muss. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit des Hauptschuldners kann der Gläubiger also direkt auf den Bürgen, in diesem Fall die GmbH, zugehen und die Forderung einfordern. Allerdings ist zu beachten, dass eine selbstschuldnerische Bürgschaft durch eine GmbH im Einzelfall gesellschaftsrechtlichen Beschränkungen unterliegen kann, insbesondere wenn sie nicht im unmittelbaren Interesse der Gesellschaft liegt. In solchen Fällen kann die Bürgschaft als verdeckte Gewinnausschüttung oder als unzulässige Einlagenrückgewähr angesehen werden, was zu steuerlichen und gesellschaftsrechtlichen Konsequenzen führen kann. Es empfiehlt sich daher, vor der Übernahme einer selbstschuldnerischen Bürgschaft durch eine GmbH, die Rechtmäßigkeit und mögliche Risiken sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls rechtlichen Rat einzuholen.
Was ist eine Gesellschafterbürgschaft?
Eine Gesellschafterbürgschaft ist eine vertragliche Verpflichtung, bei der ein Gesellschafter einer Gesellschaft, meist einer GmbH oder einer UG, gegenüber einem Gläubiger für die Schulden oder Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz der Gesellschaft tritt der bürgende Gesellschafter ein und übernimmt die finanzielle Verantwortung für die offenen Forderungen. Diese Art der Bürgschaft dient häufig als zusätzliche Sicherheit für Gläubiger, um das Risiko eines Kreditausfalls zu minimieren. Es ist wichtig zu beachten, dass die Gesellschafterbürgschaft eine persönliche Haftung des Gesellschafters begründet und somit sein Privatvermögen zur Begleichung der Forderungen herangezogen werden kann.
Kann eine GmbH Geld verleihen?
Ja, eine GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) kann grundsätzlich Geld verleihen. Als eigenständige juristische Person hat sie das Recht, Geschäfte wie beispielsweise Darlehensvergaben einzugehen. Allerdings müssen dabei bestimmte rechtliche Vorschriften und interne Regelungen beachtet werden, um die Haftung der Gesellschafter zu beschränken und die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Es ist empfehlenswert, vor der Vergabe eines Darlehens durch eine GmbH die Expertise eines Rechtsanwalts oder Steuerberaters hinzuzuziehen, um mögliche Risiken und steuerliche Auswirkungen zu minimieren.
Kann eine GmbH für eine GmbH bürgen?
Ja, grundsätzlich kann eine GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) für eine andere GmbH bürgen. In der Praxis bedeutet dies, dass die bürgende GmbH gegenüber einem Gläubiger für die Verbindlichkeiten der anderen GmbH einsteht. Dabei sollte beachtet werden, dass diese Bürgschaft im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen und dem Gesellschaftsvertrag der bürgenden GmbH steht. Eine solche Bürgschaft kann jedoch Risiken für die bürgende GmbH mit sich bringen, insbesondere wenn die andere GmbH ihren Verpflichtungen nicht nachkommt. Daher sollte eine solche Entscheidung sorgfältig abgewogen und gegebenenfalls rechtlicher Rat eingeholt werden.
Kann eine GmbH dem Geschäftsführer einen Kredit geben?
Ja, eine GmbH kann grundsätzlich ihrem Geschäftsführer einen Kredit gewähren. Allerdings müssen dabei einige rechtliche Vorschriften beachtet werden, um mögliche Haftungsrisiken und steuerliche Nachteile zu vermeiden. Der Kreditvertrag sollte schriftlich festgehalten und zu marktüblichen Konditionen abgeschlossen werden. Zudem sollte der Gesellschafterbeschluss, der die Kreditvergabe genehmigt, dokumentiert werden. Es empfiehlt sich, vor der Kreditvergabe an den Geschäftsführer den Rat eines Rechtsanwalts oder Steuerberaters einzuholen, um sicherzustellen, dass alle rechtlichen Anforderungen erfüllt sind.
Für was haftet der Geschäftsführer einer GmbH?
Der Geschäftsführer einer GmbH haftet in erster Linie für die ordnungsgemäße Geschäftsführung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Dazu zählen unter anderem die Haftung für Steuern, Sozialversicherungsbeiträge und die Einhaltung von Umwelt- und Arbeitsschutzvorschriften. Zudem kann er bei Verstößen gegen das GmbH-Gesetz, wie zum Beispiel bei fehlerhafter Gründung oder Kapitalaufbringung, haften. In bestimmten Fällen, wie Insolvenzverschleppung oder betrügerischem Verhalten, kann der Geschäftsführer auch persönlich und strafrechtlich haftbar gemacht werden.
Was ist eine Gesellschafterbürgschaft?
Eine Gesellschafterbürgschaft ist eine rechtliche Verpflichtung, bei der ein Gesellschafter eines Unternehmens persönlich für die Schulden oder Verbindlichkeiten des Unternehmens bürgt. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz des Unternehmens tritt der bürgende Gesellschafter ein und haftet mit seinem Privatvermögen für die finanziellen Verbindlichkeiten. Diese Bürgschaft dient als zusätzliche Sicherheit für Gläubiger und kann bei der Kreditvergabe oder Geschäftsverhandlungen eine wichtige Rolle spielen. Dabei sollte der Gesellschafter die Risiken und möglichen Konsequenzen einer solchen Bürgschaft sorgfältig abwägen, da sie erhebliche finanzielle Auswirkungen haben kann.
Wer darf Gesellschafterdarlehen geben?
Gesellschafterdarlehen können von den Gesellschaftern einer Gesellschaft, wie beispielsweise einer GmbH oder UG, gewährt werden. Diese Darlehen dienen der Finanzierung des Unternehmens und stellen eine Alternative oder Ergänzung zu Bankkrediten dar. Auch externe Investoren können in bestimmten Fällen Gesellschafterdarlehen gewähren, sofern sie eine Beteiligung an der Gesellschaft erwerben oder bereits halten. Es ist wichtig, die rechtlichen Rahmenbedingungen und steuerlichen Aspekte bei der Vergabe von Gesellschafterdarlehen zu beachten, um mögliche Haftungsrisiken oder steuerliche Nachteile zu vermeiden.
Was ist bei einem Gesellschafterdarlehen zu beachten?
Bei einem Gesellschafterdarlehen sind einige wichtige Aspekte zu beachten, um rechtliche Fallstricke zu vermeiden und die finanzielle Stabilität des Unternehmens zu gewährleisten. 1. Schriftliche Vereinbarung: Eine schriftliche Darlehensvereinbarung zwischen dem Gesellschafter und der Gesellschaft ist unerlässlich. Diese sollte die Darlehensbedingungen, Zinssätze, Laufzeit, Rückzahlungsmodalitäten und Sicherheiten klar festlegen. 2. Marktübliche Konditionen: Um steuerliche und rechtliche Probleme zu vermeiden, sollte das Gesellschafterdarlehen zu marktüblichen Konditionen gewährt werden. Dies bedeutet, dass Zinssätze und sonstige Bedingungen denen entsprechen sollten, die auch bei einem Fremddarlehen üblich wären. 3. Rangrücktritt: In manchen Fällen kann ein Gesellschafterdarlehen als Eigenkapitalersatz angesehen werden, insbesondere wenn ein Rangrücktritt vereinbart wurde. Dies bedeutet, dass die Rückzahlung des Darlehens im Insolvenzfall nachrangig zu den Forderungen anderer Gläubiger erfolgt. Eine solche Vereinbarung kann steuerliche und bilanzielle Auswirkungen haben und sollte sorgfältig geprüft werden. 4. Nachrangigkeit: Gesellschafterdarlehen können nachrangig oder nicht nachrangig sein. Bei nachrangigen Darlehen hat der Gesellschafter im Insolvenzfall weniger Anspruch auf Rückzahlung als andere Gläubiger. Dies kann die Bonität des Unternehmens beeinflussen und sollte bei der Gestaltung der Darlehensvereinbarung berücksichtigt werden. 5. Steuerliche Aspekte: Die steuerlichen Auswirkungen eines Gesellschafterdarlehens sollten ebenfalls beachtet werden. Zinszahlungen können als Betriebsausgaben abzugsfähig sein, während Zinseinnahmen für den Gesellschafter als Einkünfte zu versteuern sind. 6. Dokumentation: Die Gewährung und Rückzahlung von Gesellschafterdarlehen sollte sorgfältig dokumentiert werden, um möglichen Streitigkeiten oder Missverständnissen vorzubeugen. Indem Sie diese Aspekte berücksichtigen, können Sie sicherstellen, dass Ihr Gesellschafterdarlehen rechtlich einwandfrei ist und den finanziellen Bedürfnissen Ihres Unternehmens gerecht wird.
Wann haftet ein Gesellschafter einer GmbH mit seinem Privatvermögen?
Ein Gesellschafter einer GmbH haftet grundsätzlich nur mit seiner Stammeinlage und nicht mit seinem Privatvermögen. Allerdings gibt es Ausnahmen, bei denen eine persönliche Haftung des Gesellschafters mit seinem Privatvermögen eintreten kann. Diese Ausnahmen umfassen: 1. Falsche Angaben bei der Gründung: Wenn ein Gesellschafter bei der Gründung der GmbH falsche Angaben macht oder Vermögenswerte vorsätzlich überbewertet, kann er für entstandene Schäden persönlich haftbar gemacht werden. 2. Verletzung von Pflichten: Wenn ein Gesellschafter seine gesetzlichen oder vertraglichen Pflichten verletzt, beispielsweise die Einhaltung von Buchführungs- oder Informationspflichten, kann dies zu einer persönlichen Haftung führen. 3. Durchgriffshaftung: In bestimmten Fällen, wie der Vermischung von Gesellschafts- und Privatvermögen oder der missbräuchlichen Nutzung der GmbH-Struktur zur Umgehung von Gläubigeransprüchen, kann eine Durchgriffshaftung auf das Privatvermögen des Gesellschafters entstehen. 4. Nichtzahlung der Stammeinlage: Wenn ein Gesellschafter seine Stammeinlage nicht oder nur teilweise einzahlt, kann er für die fehlenden Beträge persönlich haftbar gemacht werden. 5. Insolvenzverschleppung: Wenn ein Gesellschafter bei drohender Insolvenz der GmbH nicht rechtzeitig einen Insolvenzantrag stellt, kann er persönlich haftbar gemacht werden. Es ist wichtig zu betonen, dass die persönliche Haftung eines Gesellschafters in der Regel nur bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten eintritt. Eine sorgfältige Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Pflichten sowie eine transparente Geschäftsführung sind entscheidend, um die persönliche Haftung des Gesellschafters zu vermeiden.
RA Corinna D. Ruppel (LL.M.) berät und begleitet Sie im Bankrecht, im Erbrecht, im Kapitalmarktrecht und im Insolvenzrecht. Rechtsanwältin Ruppel ist Spezialistin im Prüfen, Durchsetzen und Abwehren von Forderungen. Seit 2013 ist Frau Ruppel Inhaberin der Kanzlei CDR Legal und hat bereits über 9.000 Erstberatungen erteilt und mehr als 2.000 Mandanten vertreten.